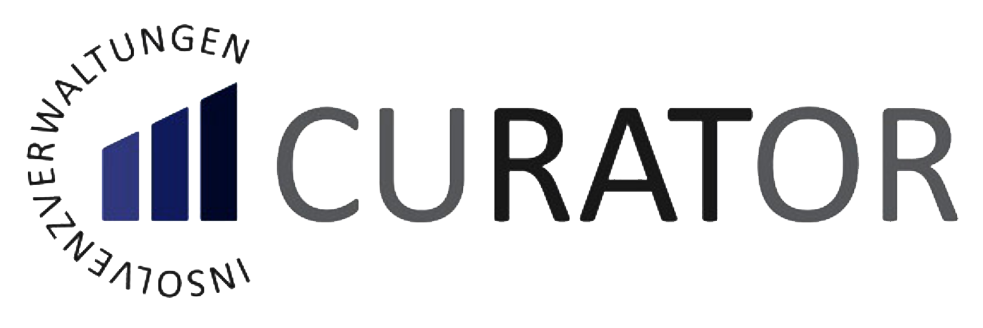Download: Steuerliche Haftung des vorläufigen Sachwalters als Verfügungsberechtigter nach §§ 69, 35 AO - Eine Entscheidungskommentierung von Dr. Dietmar Onusseit
Haftung der Vertreter für Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis
Nach § 69 der Abgabenordnung (AO) haften die in den §§ 34 und 35 AO näher bezeichneten Personen (nach der Gesetzesüberschrift: „die Vertreter“) persönlich, soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 AO) infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt oder soweit infolgedessen Steuervergütungen oder Steuererstattungen ohne rechtlichen Grund gezahlt werden.
Haftungsvoraussetzung ist deshalb zunächst, dass der vom Finanzamt (FA) in Anspruch genommene unter die in §§ 34 AO beschriebenen Vertreter oder die Verfügungsbefugten im Sinne des § 35 AO fällt. Dies sind nach § 34 Abs. 1 AO unter anderem die gesetzlichen Vertreter natürlicher oder juristischer Personen, nach dessen Abs. 3 aber auch die sogenannten Vermögensverwalter:
„Steht eine Vermögensverwaltung anderen Personen als den Eigentümern des Vermögens oder deren gesetzlichen Vertretern zu, so haben die Vermögensverwalter die in Absatz 1 bezeichneten Pflichten, soweit ihre Verwaltung reicht.“
Hierunter fallen Insolvenzverwalter, vorläufige Insolvenzverwalter bei allgemeinem Verfügungsverbot des Schuldners (§§ 21 f., 25 der Insolvenzordnung – InsO –, „starker vorläufiger Insolvenzverwalter), Zwangsverwalter, Nachlassverwalter, Testamentsvollstrecker oder Kanzleiabwickler gemäß § 55 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO). Vorläufige „schwache“ Insolvenzverwalter und die Sequester alten Rechts (Konkursordnung – KO) werden im Allgemeinen weder als Vermögensverwalter im Sinne des § 34 Abs. 3 AO noch als Verfügungsberechtigte im Sinne des § 35 AO angesehen. § 35 AO lautet:
„Wer als Verfügungsberechtigter im eigenen oder fremden Namen auftritt, hat die Pflichten eines gesetzlichen Vertreters (§ 34 Abs. 1), soweit er sie rechtlich und tatsächlich erfüllen kann.“
Im Besprechnungsurteil des Bundesfinanzhofs (BFH) ging es zum einen um die Frage, ob ein vorläufiger Sachwalter im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren nach § 270b Abs. 2 i. V. m. § 270a Abs. 1 InsO in der zur Zeit der Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung (2014) geltenden Fassung (heute § 270b Abs. 1 InsO), der die Kassenführung des Schuldners gemäß § 275 Abs. 2 InsO an sich gezogen und zu diesem Zweck ein Anderkonto eröffnet hat, als Verfügungsberechtigter nach § 35 AO zu qualifizieren ist. Zum anderen hatte der BFH zu prüfen, ob der Kläger als vorläufiger Sachverwalter für im Zeitraum des vorläufigen Insolvenzverfahrens nicht abgeführte Lohnsteuer gemäß § 69 AO persönlich haftete.
Der zu entscheidende Fall
Der Kläger wurde durch Beschluss des Amtsgerichts (AG) vom 01.12.2014 zum vorläufigen Sachwalter im Insolvenzeröffnungsverfahren in Eigenverwaltung (§ 270b InsO) über das Vermögen der A-GmbH (GmbH) bestellt. Geschäftsführer der GmbH war H. Einen Zustimmungsvorbehalt zugunsten des vorläufigen Sachwalters ordnete das AG nicht an. Im Jahr 2015 eröffnete das AG das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung und ernannte den Kläger zum Sachwalter.
Die GmbH beschäftigte 2014 mehrere Arbeitnehmer. Im Monat November 2014, also noch vor Bestellung des Klägers zum vorläufigen Sachwalter, veranlasste H die Zahlung der Löhne in voller Höhe für November 2014 und meldete Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag beim beklagten Finanzamt (FA) an.
Der Kläger zog als vorläufiger Sachwalter die Kassenführung gemäß § 275 Abs. 2 InsO an sich. Sämtliche eingehenden und ausgehenden Zahlungen wurden über ein von ihm hierfür eingerichtetes Anderkonto bei einer Bank realisiert. H überwies hierzu das gesamte Bankguthaben der GmbH auf dieses Anderkonto.
Da in der Folgezeit für den November 2014 weder Lohnsteuer noch Solidaritätszuschlag entrichtet wurden, meldete das FA beide Beträge zur Insolvenztabelle an. Die Beträge wurden zur Tabelle festgestellt und später auf der Grundlage des Insolvenzplans mit einer Insolvenzquote von gerundet 2,4% an das FA ausgezahlt. 2016 hob das AG das Insolvenzverfahren auf.
Das FA nahm den Kläger – und zudem mit gesondertem Bescheid auch den früheren Geschäftsführer H – wegen Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag für November 2014 nach § 69 i.V.m. §§ 34, 35 AO in Haftung. Die zuvor aufgrund der Insolvenzquote vereinnahmten Beträge berücksichtigte das FA bei der Berechnung der Haftungssumme nicht mindernd. Es erläuterte, der Kläger sei als vorläufiger Sachwalter, der die Kassenführung übernommen habe, Verfügungsberechtigter im Sinne des § 35 AO. Indem er die am 10.12.2014 fällige Lohnsteuer für den November 2014 nicht beglichen habe, habe er schuldhaft seine Pflichten verletzt. Dagegen legte der Kläger Einspruch ein, den das FA als unbegründet zurückwies.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) Erfolg. Auf die Revision des FA weist der BFH die Klage ganz überwiegend ab. Lediglich in Höhe der ausgezahlten Quote von 2,4 %, die das FA im Haftungsbescheid nicht abgezogen hatte, weist der BFH die Revision zurück.
Die Begründung des BFH
1. Zur Frage der Verfügungsberechtigung des Klägers Im Sinne des § 35 AO
Verfügungsberechtigter sei jeder, der rechtlich und wirtschaftlich über Mittel, die einem anderen zuzurechnen sind, verfügen kann und nach außen hin als Verfügungsberechtigter auftrete. Die Verfügungsmacht könne auf Gesetz, behördlicher oder gerichtlicher Anordnung oder Rechtsgeschäft beruhen. Die Person müsse in der Lage ist, die Pflichten eines gesetzlichen Vertreters rechtlich und tatsächlich zu erfüllen, eine rein tatsächliche Verfügungsmöglichkeit reiche dagegen nicht. Es bedürfe vielmehr auch der Fähigkeit, aufgrund bürgerlich-rechtlicher Verfügungsmacht im Außenverhältnis wirksam zu handeln.
Der BFH führt sodann an, wie er in der Vergangenheit die Rechtsstellung vorläufiger Verwalter im früheren Konkurs-, Vergleichsverfahren nach der Vergleichsordnung (VglO) und in der heutigen Insolvenz beurteilt hatte.
Danach ist der „schwache“ vorläufige Insolvenzverwalter selbst dann nicht Verfügungsberechtigter im Sinne des § 35 AO, wenn er seine Befugnisse überschreitet.
Dasselbe gilt grundsätzlich für den (vorläufigen) Sachwalter, wenn keine besonderen Umstände hinzutreten, weil dieser die wirtschaftliche Lage des Schuldners zu prüfen und dessen Geschäftsführung zu überwachen habe, ohne dass ihm eine Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners zukomme.
Dagegen hatte der BFH 1988 den Sachwalter der Vergleichsgläubiger nach § 91 Abs. 1 VglO, den der Schuldner mit notariellem Vertrag ermächtigt hatte, über sein Anlage- und Umlaufvermögen zu verfügen, als verfügungsberechtigt im Sinne das § 35 AO angesehen.
Bemerkenswerterweise bezieht sich der BFH nicht auf ein anderes Urteil desselben Senats vom 29.04.1986 (VII R 184/83), mit dem er den dortigen Sequester (vorläufiger Verwalter nach der KO) weder als Vermögensverwalter nach § 34 Abs. 3 AO noch als Verfügungsberechtigten gemäß § 35 AO qualifiziert hatte, obwohl das Konkursgericht ein allgemeines Veräußerungs- und Verfügungsverbot gegen die Schuldnerin erlassen und den Sequester beauftragt hatte, „den Geschäftsbetrieb zu übernehmen“.
Im juristischen Schrifttum ist umstritten, ob der vorläufige Sachwalter durch die Übernahme der Kassenführung zum Verfügungsberechtigten nach § 35 AO wird. Teilweise wird die Frage verneint, teilweise bejaht, einzelne Autoren plädieren für die Anwendung des § 35 AO, wenn der (vorläufige) Sachwalter die Kassenführung übernimmt und weitere Berechtigungen hinzukommen.
Der BFH folgt der letztgenannten Auffassung mit der Maßgabe, dass ein vorläufiger Sachwalter zumindest dann als Verfügungsberechtigter anzusehen ist, wenn er nach Übernahme der Kassenführung auf seinen Namen ein Anderkonto bei einer Bank eröffnet und sämtliche eingehenden und ausgehenden Zahlungen des Schuldners über dieses Konto abwickelt.
Er erlange hierdurch die für eine Verfügungsberechtigung im Sinne von § 35 AO erforderliche rechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmacht. Im Streitfall folgten diese treuhänderischen Befugnisse aus der Verwendung des Anderkontos, durch das der Kläger zudem als Verfügungsberechtigter nach außen aufgetreten sei. Bei dem eingerichteten Rechtsanwaltsanderkonto handele es sich nicht um ein Konto der Insolvenzmasse, sondern um ein offenes Vollrechtstreuhandkonto, dessen Inhaber, hier der Kläger, die Verfügungsmacht über das Konto selbst und die darauf befindlichen Mittel erlange.
Dass der Kläger, wie dieser meint, nur Aufweisung des Schuldners habe handeln dürfe, sei als Absprache im Innenverhältnis belanglos.
Der Kläger habe die Verfügungsmacht auch nach außen genutzt, indem er das Konto eingerichtet und darüber verfügt habe.
2. Zu den Voraussetzungen der Haftung nach 69 AO
§ 69 AO lautet:
„Die in den § 34 und § 35 bezeichneten Personen haften, soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37) infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt oder soweit infolgedessen Steuervergütungen oder Steuererstattungen ohne rechtlichen Grund gezahlt werden. …“
Obwohl § 69 AO eine relativ einfach formulierte Vorschrift zu beinhalten scheint, setzt er für die Haftungsinanspruchnahme neben der Eigenschaft des Haftenden als Vertreter oder Verfügungsberechtigter mehreres voraus:
- den Eintritt eines Haftungsschadens,
- eine Pflichtverletzung,
- einen Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Haftungsschaden,
- ein Verschulden,
- das Nichteingreifen des Grundsatzes der anteiligen Tilgung und letztlich
- fehlfreie Ermessenausübung durch das FA bei Erlass des Haftungsbescheids nach § 191 Abs. 1 AO, die einzige Voraussetzung, die vorliegend in der Revisionsinstanz unstreitig war.
a) Haftungsschaden
Ein Haftungsschaden im Sinne von § 69 AO sei eingetreten, legt der BFH dar, weil die Forderung des FA auf Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag, mithin Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nach § 37 AO, nicht erfüllt worden seien.
b) Pflichtverletzung durch den Kläger
Nach dem insoweit maßgeblichen Haftungsbescheid hatte das FA eine Pflichtverletzung des Klägers darin gesehen, dass er die am 10.12.2014 fällige Lohnsteuer für November 2014 nicht beglichen hatte.
Dem schließt sich der BFH an. Als Verfügungsberechtigter habe der Kläger gemäß § 35 AO die Pflichten eines gesetzlichen Vertreters gehabt, die er auch rechtlich und tatsächlich habe erfüllen können. Er habe dafür zu sorgen gehabt, dass die Steuern aus den Mitteln entrichtet wurden, die er verwaltete. Die in Rede stehenden Steuern habe er jedoch nicht abgeführt.
Die Pflichtverletzung sei trotz des Insolvenzantrags nicht wegen einer Pflichtenkollision ausgeschlossen gewesen. Zwar habe ein Geschäftsführer bei Eintritt von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nach § 64 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung (GmbHG) eine Massesicherungspflicht, nach der Rechtsprechung des BFH hafte er jedoch nicht nach dieser Vorschrift gegenüber der Gesellschaft, weil die Erfüllung steuerlicher Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns im Sinne des § 64 Satz 2 GmbHG a. F. vereinbar gewesen sei. Das habe auch für den vorläufigen Sachwalter zu gelten.
Nach dem jetzt geltenden §15b Abs. 8 InsO, der unter anderem § 64 GmbHG abgelöst hat, liegt eine Verletzung steuerrechtlicher Zahlungspflichten nicht vor, wenn zwischen dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung und der Entscheidung des Insolvenzgerichts über den Insolvenzantrag Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden, sofern die Antragspflichtigen ihren Verpflichtungen nach § 15a InsO nachkommen. Diese Vorschrift gilt jedoch erst ab dem 01.01.2021. Der BFH wendet sie vorliegend deshalb ausdrücklich nicht (rückwirkend) an.
Ungeprüft lässt der BFH bei allem, ob § 64 GmbHG a. F. bzw. § 15b InsO auf den vorläufigen Sachwalter überhaupt anwendbar sind, was erheblichen Zweifeln unterliegt.
c) Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Haftungsschaden
Der notwendige Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Haftungsschaden bestehe. Dass der Kläger, wie dieser vorgetragen habe, als späterer Sachwalter im Falle einer Abführung der Lohnsteuer im Zeitpunkt der Fälligkeit diese Zahlung nach § 130 Abs. Abs. 1 Nr. 2 InsO zweifelsfrei angefochten hätte und das FA die Beträge hätte zurückzahlen müssen, vermöge den Kausalzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und dem Haftungsschaden nicht zu beseitigen. Denn hypothetische (nur gedachte) Geschehensläufe seien bei der Beurteilung des Kausalzusammenhangs zwischen der Pflichtverletzung und dem Haftungsschaden nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats unbeachtlich. Hieran ändere nichts, dass der Kläger späterhin auch selbst in Person zum Sachwalter im eröffneten Eigenverwaltungsverfahren bestellt worden sei.
d) Verschulden
Den Kläger treffe ferner ein Verschulden daran, dass die Lohnsteuer für November 2014 bei Fälligkeit nicht an das FA abgeführt worden sei. Nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats stelle die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Pflichtverletzung dar. Zudem indiziere nach ebenso ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats die objektive Pflichtwidrigkeit des Verhaltens generell das Verschulden im Sinne von § 69 Satz 1 AO.
Gegenteilige Anhaltspunkte ergäben sich insbesondere nicht daraus, dass dem Kläger im Haftungszeitraum die Rechtslage noch nicht hinreichend bekannt gewesen wäre. Zwar habe sich in der zivilgerichtlichen Rechtsprechung erst in jüngerer Zeit – nach dem Haftungszeitraum – die Erkenntnis verfestigt, dass es für einen Insolvenzverwalter nicht zulässig sei, ein Anderkonto einzurichten. Vielmehr müsse der Insolvenzverwalter ein Konto unterhalten, aus dem die Insolvenzmasse selbst materiell berechtigt sei. Dies dürfe aufgrund der erforderlichen Trennung zwischen künftiger Insolvenzmasse und dem Vermögen des Sachwalters ebenso für einen vorläufigen Sachwalter gelten. Die Haftung des Klägers beruhe jedoch nicht hierauf, sondern vielmehr darauf, dass er mit dem Anderkonto ein offenes Vollrechtstreuhandkonto eingerichtet habe, woraus die für die Stellung als Verfügungsberechtigter im Sinne von § 35 AO erforderliche rechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmacht aufgrund der Treuhand abzuleiten sei. Diese Umstände seien dem Kläger bekannt gewesen.
e) Nichteingreifen des Grundsatzes der anteiligen Tilgung
Eine Haftung sei auch nicht deshalb zu verneinen oder in ihrem Umfang zu reduzieren, weil zur Begleichung der Steuerschulden nicht ausreichende Mittel vorhanden gewesen wären.
Stünden zur Begleichung der Schulden insgesamt keine ausreichenden Mittel zur Verfügung, so bewirke nach der Rechtsprechung die durch die schuldhafte Pflichtverletzung verursachte Nichterfüllung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis die Haftung nur in dem Umfang, in dem der Verpflichtete das FA gegenüber den anderen Gläubigern benachteiligt habe. Diesem sogenannten Grundsatz der anteiligen Tilgung komme im Zusammenhang mit der Lohnsteuer allerdings die eingeschränkte Bedeutung zu, dass lediglich das FA und die Arbeitnehmer gleichmäßig zu berücksichtigen seien. Daher seien die für die Lohnsteuerabführung erforderlichen Beträge bei der Lohnzahlung zurückzubehalten, die Löhne also entsprechend zu kürzen.
Ob im Streitfall der Grundsatz der anteiligen Tilgung aber möglicherweise trotz Vorliegens eines Lohnsteuerfalls in uneingeschränktem Umfang anzuwenden sein könnte, weil die Löhne bereits vor der Bestellung des Klägers zum vorläufigen Sachwalter durch den Geschäftsführer H ausgezahlt worden waren und der Kläger daher keine Möglichkeit gehabt habe, für eine Kürzung der Löhne zu sorgen, könne dahinstehen. Denn von dem Bestand auf dem Anderkonto des Klägers hätte er weniger als ein Zehntel für die offenen Steuerforderungen verwenden müssen. Sofern zu einem späteren Zeitpunkt das Vermögen der GmbH unter Berücksichtigung anderer Gläubiger nicht ausgereicht haben sollte, worauf die Insolvenzquote von 2,4% schließen lasse, gelte dies zumindest nicht für den insoweit maßgeblichen Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuerschulden am 10.12.2014.
Nach allem sah sich der BFH veranlasst, das Urteil des FG, das gegenteilig entschieden hatte, weitestgehend aufzuheben.