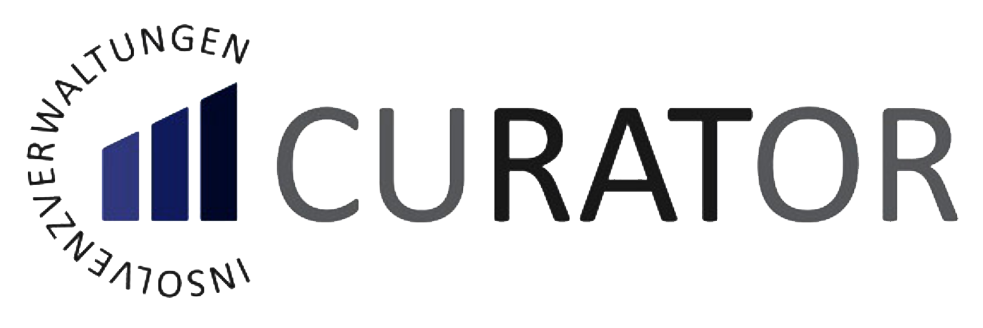Download: Abtretung des Insolvenzanfechtungsanspruchs? Zulässigkeit und Rechtsfolgen
Allgemeines
Die Besprechungsentscheidung behandelt eine Vielzahl insolvenzrechtlicher Probleme. Hierzu zunächst eine Übersicht:
- Abtretbarkeit des Insolvenzanfechtungsanspruchs
Die Ausübung des Insolvenzanfechtungsrechts ist im Grundsatz untrennbar mit dem Amt des Insolvenzverwalters verbunden. Daher war früher höchst streitig, ob der Verwalter den Anspruch wirksam abtreten kann. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich jedoch mit Urteil vom 17.02.2011 (IX ZR 91/10) für die Abtretbarkeit entschieden, und dies seitdem mehrfach bestätigt, so auch mit der Besprechungsentscheidung. Die Abtretung darf allerdings nicht insolvenzzweckwidrig sein, was angenommen wird, wenn die Insolvenzmasse keine Gegenleistung erhält. Wird eine unangemessen niedrige Gegenleistung vereinbart, ist die Abtretung zwar wirksam, der Insolvenzverwalter haftet jedoch persönlich nach § 60 der Insolvenzordnung (InsO), wenn der Masse hieraus ein Schaden entsteht. Auch dies bestätigt die Besprechungsentscheidung.
- Wirkungen der Aufhebung des Insolvenzverfahrens auf den abgetretenen Anspruch
Der Insolvenzanfechtungsanspruch erlischt mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Ob dies auch zu gelten hat, wenn der Insolvenzverwalter den Anspruch abgetreten hatte, ist vom BGH bisher nicht geklärt gewesen. Damit befasst sich nun die Besprechungsentscheidung.
- Wirkungen der Verjährung des Anfechtungsanspruchs auf die Rechte des Zessionars des Anfechtungsanspruchs
Der Anfechtungsanspruch verjährt nach § 146 Abs. 1 InsO nach der Regelverjährung, das heißt, die dreijährige Verjährungsfrist des § 195 BGB beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Der Anfechtungsanspruch entsteht mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Allerdings muss der Insolvenzverwalter als Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners, also hier des Anfechtungsgegners, Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangt haben müssen. Tritt dieser Umstand erst nach dem Jahr der Verfahrenseröffnung ein, verschiebt sich der Beginn des Laufs der Verjährungsfrist entsprechend, in Einzelfällen auch um einige Jahre.
Ist der Anfechtungsanspruch verjährt, kann der Insolvenzverwalter ihn nicht mehr aktiv durchsetzen. Nach § 146 Abs. 2 InsO kann er allerdings auch dann noch die Erfüllung einer Leistungspflicht verweigern, wenn sie durch eine anfechtbare Rechtshandlung begründet wurde, also etwa die Herausgabe von Sicherungsgut verweigern, wenn das Sicherungsrecht anfechtbar gewährt wurde. Die Besprechungsentscheidung klärt die Frage, ob diese Vergünstigung auch für den Zessionar des Anfechtungsanspruchs greift.
- Feststellung des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes
Die sogenannte Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO erfordert die Feststellung des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes des Schuldners und diejenige der Kenntnis des Anfechtungsgegners vom Vorsatz des Schuldners. Bis 2021 nahm die Rechtsprechung – etwas verkürzt ausgeführt – an, der Schuldner handele mit dem erforderlichen Vorsatz, wenn er im Zeitpunkt der angefochtenen Rechtshandlung zahlungsunfähig war und dies erkannt hatte.
Der BGH hat jedoch mit Urteil vom 06.05.2021 (IX ZR 72/20) die Voraussetzungen für die Anfechtung nach § 133 InsO erheblich verschärft. Danach reicht es jetzt im Fall kongruenter Deckungen (der Anfechtungsgegner hat als Gläubiger genau das erhalten, worauf er einen Anspruch hatte) nicht mehr aus, dass der Schuldner erkannt zahlungsunfähig war, es muss vielmehr hinzukommen, dass der Schuldner ausgehend von objektiven Anhaltspunkten aus der Sicht ex ante selbst bei optimistischer Betrachtung unzweifelhaft auch in Zukunft nicht in der Lage sein wird, seine Verbindlichkeiten vollständig zu befriedigen.
Anders ist es, wenn der Anfechtungsgegner eine Deckung oder Sicherung erhalten hat, die er nicht oder jedenfalls nicht so verlangen konnte, also etwa statt Zahlung lediglich eine Sicherheit, zum Beispiel die Sicherungsübereignung eines PKW (inkongruente Leistung). Die Inkongruenz wird vom BGH als starkes Beweisanzeichen für den Vorsatz gewertet, jedenfalls dann, wenn sich der Schuldner im Zeitpunkt der angefochtenen Rechtshandlung objektiv in beengten finanziellen Verhältnissen befand. Für die Kenntnis des Anfechtungsgegners vom Vorsatz soll es sogar ausreichen, dass er im Zeitpunkt der Rechtshandlung Anlass hatte, an der Liquidität des Schuldners zu zweifeln.
Der zu entscheidende Fall
Der spätere Insolvenzschuldner konnte spätestens ab 2009 eine gegen ihn und andere als Gesamtschuldner titulierte Forderung über 2,5 Mio. € nicht begleichen, selbst den internen Gesamtschuldnerausgleich konnte er nicht stemmen. Zu den weiteren Gesamtschuldnern gehörte auch sein Bruder, der spätere Kläger des vorliegenden Verfahrens.
Bereits 2005 hatte der Schuldner allerdings eine Erklärung („Schuldschein/Schuldanerkenntnis“) der späteren Beklagten erhalten, in der diese einen Schuldbetrag von 600.000 € bestätigte.
Der Schuldner trat die Forderung aus dem „Schuldschein“ am 10.03.2010 an den Kläger ab. Am 12.08.2013 wurde über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter forderte den Kläger später zur Rückabtretung auf, eine Rückabtretung erfolgte jedoch nicht.
Im Jahr 2016 erhob der Kläger Klage gegen die Beklagte auf Zahlung der 600.000 €. Am 22.12.2016 trat der Insolvenzverwalter die Anfechtungsforderung gegen den Kläger an die Beklagte ab und im Jahr 2018 wurde das Insolvenzverfahren aufgehoben.
Im Rechtsstreit mit dem Kläger machte die Beklagte mit Schriftsatz vom 09.01.2019 hilfsweise ein Zurückbehaltungsrecht im Hinblick auf den ihr abgetretenen Insolvenzanfechtungsanspruch geltend und stütze sich dazu auf den Einwand unzulässiger Rechtsausübung nach § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), den sogenannten dolo-agit-Einwand (dolo agit qui petit, quod statim redditurus est – Arglistig handelt, wer fordert, was er sogleich zurückzugeben hat). Ob der Anfechtungsanspruch zu diesem Zeitpunkt verjährt war, hatte das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg nicht festgestellt.
Das Verfahren befand sich im zweiten Rechtszug, da der BGH die Sache bereits im Jahr 2022 aufgehoben und an das OLG) zurückverwiesen hatte. Im zweiten Rechtszug wies das OLG die Klage ab. Auf die Revision des Klägers hob der BGH die Sache jetzt zum zweiten Mal auf und verwies sie erneut an das OLG zurück, das sich nun mit der Verjährung zu befassen haben wird.
Der BGH stellt seinem Urteil folgende Leitsätze voraus:
1. Hat der Schuldner eine Forderung gegen einen Drittschuldner in anfechtbarer Weise an einen Dritten abgetreten, führt nicht schon die Abtretung des anfechtungsrechtlichen Rückgewähranspruchs gegen den Dritten an den Drittschuldner zu einer Vereinigung von Forderung und Schuld in der Person des Drittschuldners (Konfusion).
2. Der anfechtungsrechtliche Rückgewähranspruch erlischt nach seiner Abtretung an einen Dritten nicht mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens.
3. Ist der Anfechtungsanspruch verjährt, ist der Zessionar des Anfechtungsanspruchs nicht berechtigt, die Erfüllung einer Leistungspflicht zu verweigern, die auf einer anfechtbaren Handlung beruht.
4. Für die Erhebung des Einwands unzulässiger Rechtsausübung (dolo-agit-Einwand) kommt es maßgeblich darauf an, dass der vom Schuldner geltend gemachte Gegenanspruch im Zeitpunkt der erstmaligen Geltendmachung des dolo-agit-Einwands im Prozess unverjährt ist; der spätere Eintritt der Verjährung ist insoweit ohne Bedeutung.
Die Begründung des BGH
Das OLG hatte im zweiten Berufungsurteil angenommen, dass die Zession der Rechte aus dem „Schuldschein“ nach § 133 InsO anfechtbar sei und dass die Abtretung des Anfechtungsanspruchs an die Beklagte zum Erlöschen der Forderung aus dem „Schuldschein“ durch Konfusion geführt habe. Eine Konfusion wird etwa angenommen, wenn der Schuldner der Forderung diese erwirbt.
Letzteres bestätigt auch der BGH, er urteilt jedoch, dass es vorliegend nicht zu einer Konfusion gekommen sei, denn die Anfechtbarkeit einer Rechtshandlung führe nicht dazu, dass sie als wirkungslos zu behandeln sei. Im Beispiel der Abtretung bedeute das, dass die Abtretung nicht durch die mit der Insolvenzeröffnung entstehende Anfechtbarkeit entfalle, sondern nur, dass dem Insolvenzverwalter ein Anspruch auf Rückabtretung zustehe. Erst wenn der Anfechtungsgegner diesen Anspruch, gegebenenfalls auch durch Zwangsvollstreckung, an die Masse zurückabtrete, entfalle die Wirkung der Anfechtung. Da vorliegend der Kläger die Forderung aus dem „Schuldschein“ entgegen der Aufforderung des Insolvenzverwalters nicht zurückabgetreten habe, stehe ihm diese Forderung nach wie vor zu, er sei allerdings dem Rückabtretungsanspruch bis zu dessen Verjährung dauerhaft ausgesetzt. In der Folge hätten Anspruch und Schuld aus dem „Schuldschein“ trotz der Abtretung durch den Verwalter an die Beklagte nicht in deren Person zusammenfallen, mithin keine Konfusion eintreten können.
Es kam jedoch in Betracht, dass der Beklagten ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber der Klageforderung im Hinblick auf das ihr abgetretene Anfechtungsrecht zustand, weil sie sich möglicherweise auf den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung berufen konnte (dolo agit – siehe oben).
Eine Klageforderung sei dann wegen unzulässiger Rechtsausübung in voller Höhe nicht durchsetzbar, so der BGH, wenn dem Schuldner gegen den Gläubiger seinerseits ein (Gegen-)Anspruch zustehe, welcher der Klageforderung der Höhe nach entspreche oder diese übersteige. Weiter sei erforderlich, dass die Gegenforderung durchsetzbar sei, ein Prozess auf Rückgewähr also erfolgreich geführt werden könnte. Das gelte entsprechend für den Fall, dass der Schuldner der Klageforderung dieser einen infolge Abtretung erworbenen anfechtungsrechtlichen Rückgewähranspruch entgegenhalte. Denn der anfechtbare Rechtserwerb sei auf die Anfechtung des Verwalters hin der Insolvenzmasse wieder zuzuführen. Demgemäß könne die Anfechtbarkeit des Rechtserwerbs dem Gläubiger als Einwendung entgegengehalten werden. Dieses Recht stehe auch dem Zessionar eines Anfechtungsanspruchs zu.
Der BGH prüft sodann die Anfechtbarkeit der Abtretung an den Kläger nach § 133 InsO. Das OLG hatte hierin eine kongruente Leistung gesehen und trotz der erschwerten Anforderungen (siehe oben) die Anfechtbarkeit bejaht. Letzteres bestätigt der BGH, weil der Schuldner in Anbetracht seiner erheblichen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,5 Mio. € auch zukünftig nicht in der Lage sein werde, seine Schulden vollständig zu begleichen. Allerdings sei die Abtretung inkongruent gewesen, weil der Kläger keinen Anspruch hierauf gehabt habe, sodass sogar die geringeren Anforderungen an die Vorsatzfeststellung bei Inkongruenz zur Anwendung kämen. Da der Schuldner sich eindeutig in beengten finanziellen Verhältnissen befunden habe und der Kläger hiervon Kenntnis gehabt habe, sei die Abtretung nach § 133 InsO anfechtbar.
Dass das Insolvenzverfahren zwischenzeitlich aufgehoben worden sei, sei vorliegend bedeutungslos.
Allerdings erlösche das Anfechtungsrecht des Insolvenzverwalters mit der vorbehaltlosen Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens. Ob dies auch im Fall der Abtretung des Anfechtungsanspruchs gelte, sei in der juristischen Literatur umstritten. Der BGH schließt sich der Meinung an, die dies verneint, was wie folgt begründet wird.
Zweck des Anfechtungsanspruchs sei es, Vermögensverschiebungen vor Insolvenzeröffnung zugunsten der Insolvenzgläubiger zu korrigieren. Der Anfechtungsanspruch erlösche mit Beendigung des Verfahrens, weil der Anspruch den Gläubigern nicht mehr zugutekommen und damit sein Zweck nicht mehr erreicht werden könne. Mit der Abtretung des Anfechtungsanspruchs und dem zugrunde liegenden Kausalgeschäft werde der Wert des Anfechtungsanspruchs jedoch bereits zur Masse gezogen.
Soweit der Zessionar die Gegenleistung noch nicht an die Masse erbracht habe oder eine Gegenleistung erst nach oder in Abhängigkeit von einer erfolgreichen Durchsetzung des Anfechtungsanspruchs schulde, bedürfe es hinsichtlich dieser Gegenleistung der Anordnung einer Nachtragsverteilung. Dies habe jedoch auf den Fortbestand des abgetretenen Anfechtungsanspruchs keinen Einfluss. Im Ergebnis kann der Zessionar den Anfechtungsanspruch daher auch noch nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens weiterverfolgen.
Allerdings, so der BGH weiter, lasse sich auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des OLG nicht ausschließen, dass der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung an der Verjährung des anfechtungsrechtlichen Rückgewähranspruchs scheitere. Denn der Einwand könne nur erhoben werden, wenn der anfechtungsrechtliche Rückgewähranspruch, den die Beklagte dem Kläger im Wege des dolo-agit-Einwands entgegenhalte, im Zeitpunkt seiner erstmaligen Geltendmachung im Prozess mit Schriftsatz vom 09.01.2019 noch nicht verjährt gewesen sei, wozu das OLG nichts festgestellt habe.
Der Einwand unzulässiger Rechtsausübung aus § 242 BGB sei eine unselbständige Einwendung, die mit dem (Gegen-)Anspruch (hier dem Anfechtungsanspruch) verjähre, aus dem sie abgeleitet werde.
Auf die Regelung des § 146 Abs. 2 InsO, die dem Insolvenzverwalter ein unverjährbares Leistungsverweigerungsrecht einräume, könne sich die Beklagte als Zessionarin nicht berufen. Nach dieser Vorschrift könne der Insolvenzverwalter die Erfüllung einer Leistungspflicht verweigern, die auf einer anfechtbaren Handlung beruhe, auch wenn der Anfechtungsanspruch verjährt sei. Der Wortlaut des § 146 Abs. 2 InsO stelle allein auf den Insolvenzverwalter ab. Eine analoge Anwendung zugunsten der Beklagten als der neuen Gläubigerin des Rückgewähranspruchs scheide aus.
Die analoge Anwendung einer Vorschrift erfordere zum einen eine planwidrige Regelungslücke, zum anderen die Vergleichbarkeit der zur Beurteilung stehenden Sachverhalte. Der zu beurteilende Sachverhalt müsse in rechtlicher Hinsicht so weit mit dem Tatbestand, den der Gesetzgeber geregelt habe, vergleichbar sein, dass angenommen werden könne, er wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen. Vorliegend fehle jedenfalls die Vergleichbarkeit der Interessenlage der Beklagten als neuen Gläubigerin mit derjenigen des Insolvenzverwalters.
§ 146 Abs. 2 InsO diene dem Schutz der Insolvenzmasse. Schon zur vergleichbaren Vorgängervorschrift des § 41 Abs. 2 der früheren Konkursordnung (KO) habe der BGH ausgeführt, dass die Vorschrift allein den Sinn habe, Ansprüche gegen die Masse und Leistungen aus der Masse abzuwehren, wenn sie unmittelbar oder mittelbar auf anfechtbaren Handlungen beruhten. Es solle verhindert werden, dass Gegenstände und Rechte, die noch in der Masse vorhanden seien, aufgrund eines anfechtbaren Rechtserwerbs deshalb der Masse entzogen werden, weil die Ausschlussfrist für die Ausübung des Anfechtungsrechts versäumt worden sei. § 146 Abs. 2 InsO beruhe wie § 41 Abs. 2 KO auf dem der Billigkeit entsprechenden Gedanken, dass der Anfechtungsgegner nach Ablauf der Anfechtungsfrist nicht die durch die anfechtbare Handlung begründete Leistungspflicht einfordern können solle.
Die Interessenlage der Beklagten als Zessionarin unterscheide sich hiervon. Zum einen werde sie ausschließlich im Eigeninteresse und nicht zugunsten der Masse tätig, zum anderen fehle es im Streitfall an dem von § 146 Abs. 2 InsO vorausgesetzten Zusammenhang zwischen anfechtbarer Handlung und der abzuwehrenden Leistungspflicht, „die auf einer anfechtbaren Handlung beruht“. Die Beklagte verweigere nicht die Erfüllung einer Leistungspflicht, die auf einer anfechtbaren Handlung beruhe und im Ausgangspunkt gegen die Masse gerichtet gewesen sei. Vielmehr verweigere die Beklagte die Erfüllung der gegenüber dem Zedenten als Insolvenzschuldner bestehenden eigenen Leistungspflicht, deren neuer Gläubiger der Kläger durch die anfechtbare Rechtshandlung geworden sei.
Jedoch bliebe der Beklagten der Einwand unzulässiger Rechtsausübung erhalten, wenn der anfechtungsrechtliche Rückgewähranspruch als (Gegen-)Anspruch erst nach seiner erstmaligen Geltendmachung in noch unverjährter Zeit im weiteren Verlauf des Prozesses verjährt sei. Ausreichend sei, dass der dolo-agit-Einwand im Prozess rechtzeitig, also vor Verjährung des (Gegen-)Anspruchs der Beklagten geltend gemacht worden sei.
Das Urteil des OLG sei daher aufzuheben und die Sache an das OLG zurückzuverweisen, das die Frage der Verjährung des Anfechtungsanspruchs nunmehr zu klären habe.